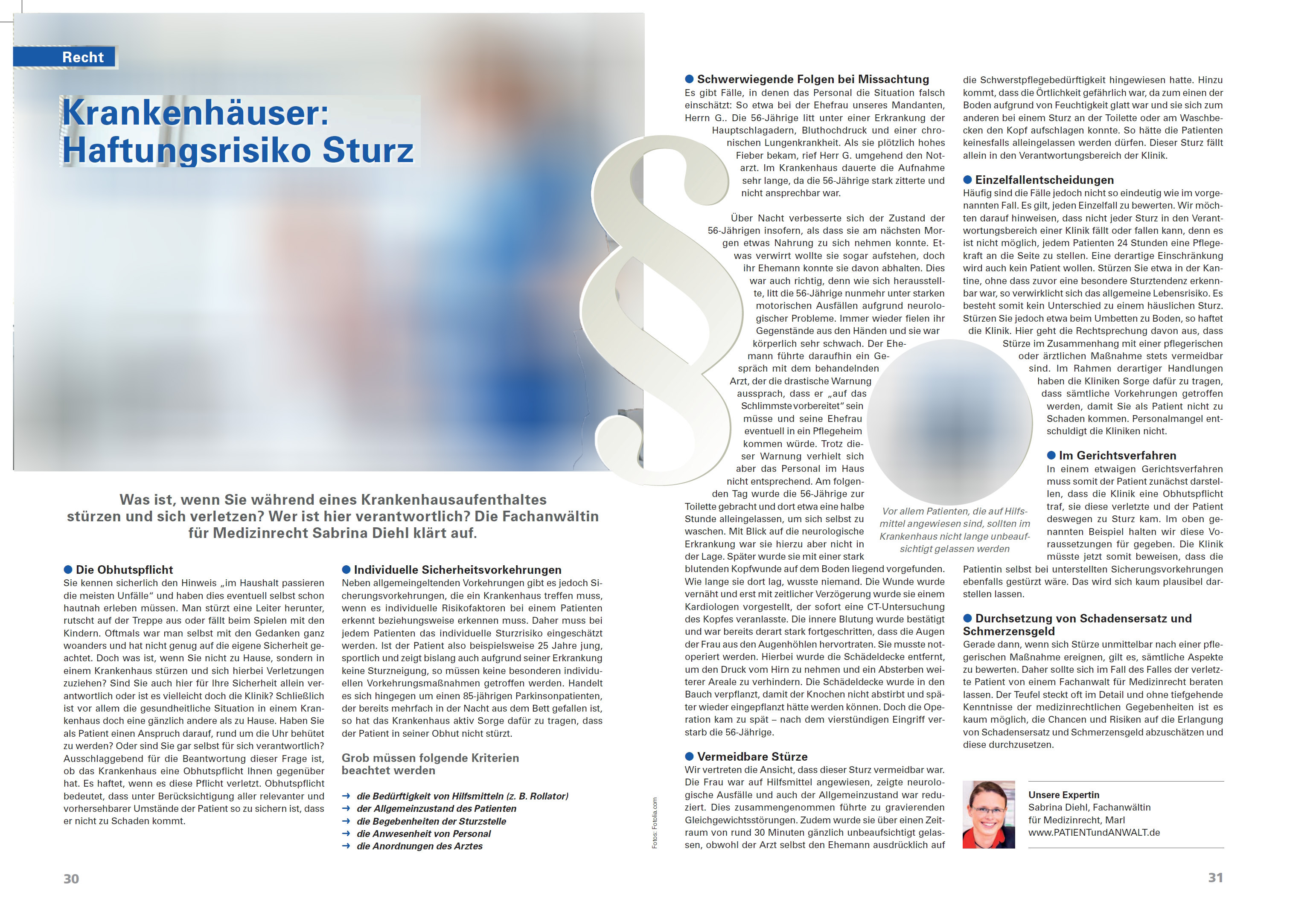Das Magazin aus Ihrer Apotheke Ausgabe 6/2017 - Aufklärung vor medizinischem Eingriff muss sein
- Presse
- Printmedien
Quelle „TV GESUND & LEBEN".
Im Medizinrecht verhält es sich so, dass der Patient die Beweislast für das Vorliegen eines Behandlungsfehlers trägt. Das heißt, der Patient muss beweisen, dass es sich um einen Fehler seitens des Arztes handelt, der zu einer Gesundheitsschädigung geführt hat.
Wurde jedoch der Patient vor einer ärztlichen Behandlung, vor allem vor einer Operation, fehlerhaft über die Risiken eines Eingriffes aufgeklärt – man spricht hier vom sogenannten Aufklärungsfehler –, trägt der Arzt die Beweislast dafür, dass er den Patienten ordnungsgemäß aufgeklärt hat.
Wenn Sie als Patient beispielsweise nach einer Operation das Eintreten eines medizinischen Risikos des vorangegangenen Eingriffes erleben, über das der Arzt Sie zuvor nicht aufgeklärt hat, so kann oftmals erfolgreich eine Klage auf Schadensersatz und Schmerzensgeld durchgesetzt werden. Selbst dann, wenn objektiv dem Arzt im Rahmen des Eingriffes überhaupt kein Fehler unterlaufen ist. Laut § 630 e Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) hat ein Patient Anspruch auf eine umfassende Aufklärung.
Eine umfassende Aufklärung besteht aus 6 Teilen:
1. Diagnose - Sie müssen wissen, worum es geht
Während es früher im Ermessen des Arztes lag, inwieweit ein Patient über die vom Arzt getroffene Diagnose aufgeklärt wird, gilt heute – und meiner Meinung nach auch völlig zu Recht –, dass Sie als Patient umfassend über die Diagnose aufzuklären sind. Dies bedeutet, Ihr Arzt hat Ihnen jedes Detail über die Diagnose zu erklären.
2. Verlauf - Was kommt auf Sie zu?
Der Verlauf der Behandlung muss nicht in jedem minimalen Detail dargelegt werden. Es geht aber darum, dass Sie als Patient durch die Darlegung des Verlaufs einer Behandlung oder Operation so aufgeklärt sind, dass Sie sich ein Bild davon machen können, was auf sie zukommen kann. Sie müssen die Chancen und Risiken abschätzen können, damit Sie entscheiden können, ob Sie den Eingriff wollen oder nicht. Vor allem etwaige Folgen für die Lebensführung und die Arbeitsfähigkeit müssen Ihnen klar sein. Dabei reicht es nicht aus, wenn Sie einen allgemein gehaltenen Aufklärungsbogen unterschreiben. Denn die individuelle Vorgeschichte sollte im Rahmen der Risikoabwägung berücksichtigt werden. Es muss ein individuell geführtes Aufklärungsgespräch geführt werden.
3. Risiken - Wass kann passieren, wenn etwas schief läuft?
Eine Behandlung oder OP kann natürlich Risiken bergen. Der Arzt ist allerdings nicht verpflichtet, jedes einzelne Risiko zu benennen. Ob der Arzt ein Risiko darzulegen hat, wird nicht dadurch entschieden, wie oft ein Risiko auftritt, sondern wie schwerwiegend das Auftreten des jeweiligen Risikos sein kann und wie überraschend es den Betroffenen treffen würde. Diese Risiken sind Ihnen so darzulegen, dass Sie verstehen, wie schwerwiegend sie sein können und was diese für Ihr weiteres Leben bedeuten würden. Bei Verfahren, die noch neu sind und deren Risiken demnach kaum abschätzbar sind, muss der Arzt auch auf diesen Umstand hinweisen. Er kann sich also nicht damit verteidigen, dass er selbst noch nicht einmal die Risiken abschätzen konnte. Es gilt, je dringlicher ein Eingriff oder eine Behandlung ist, desto geringer sind die Anforderungen an die Aufklärung. Allerdings steigen die Anforderungen an die Aufklärung, je gefährlicher und risikobehafteter die Behandlung ist. Besonders bei Eingriffen, die nicht medizinisch notwendig sind, wie bei kosmetischen Eingriffen, ist schonungslos über sämtliche Risiken aufzuklären.
4. Therapie – Wie geht es weiter?
Der Arzt ist, auch wenn er nach der Operation nicht weiter der behandelnde Arzt ist, dazu verpflichtet, Sie darüber aufzuklären, wie es nach der Operation weitergeht und hat Sie zu animieren, sich therapieunterstützend zu verhalten. Das ist die sogenannte Sicherungsaufklärung. Bei der Beratung zur geeigneten Therapie handelt es sich allerdings rechtlich um einen Teil der Behandlung und sie ist somit kein Aufklärungsfehler. Das wiederum bedeutet, dass der Patient zu beweisen hat, dass es sich um eine fehlerhafte Beratung handelte.
5. Wirtschaftliche Aufklärung – Keine böse Überraschung bei der Rechnung
Sollten Sie sich einer Behandlung unterziehen, deren Kosten nicht vollständig von einer Krankenversicherung abgedeckt sind, hat der Arzt Sie über die zu erwartenden Kosten vollständig aufzuklären. Besonders häufig ist dies bei den sogenannten IGeL (Individuelle Gesundheitsleistungen) der Fall.
5. Versicherungsrechtliche Aufklärung – Gibt es Alternativen, die günstiger sind?
Bietet der Arzt Ihnen eine kostenpflichtige Privatleistung an und gibt es daneben eine gleichwertige kassenärztliche Leistung, muss der Arzt Sie auch hierüber aufklären. Privatleistungen dürfen nicht einfach vorgezogen werden. Neben diesen 6 essenziellen Bestandteilen der Aufklärung ist auch der Rahmen, in dem die Aufklärung stattfindet, für den Erfolg der Aufklärung ausschlaggebend und somit Bestandteil der Bewertung bei einem vorgeworfenen Aufklärungsfehler.
Wie wurde aufgeklärt?
Die Aufklärung ist stets durch den behandelnden Arzt zu leisten. Ausgenommen sind Ärzte in Krankenhäusern. Hier kann die Aufklärung auch durch einen anderen Arzt vorgenommen werden. Dieser muss kein Facharzt sein, sondern lediglich die fachlichen Kenntnisse besitzen, um eine qualifizierte Aufklärung zu gewährleisten. Nichtärztliches Personal hingegen ist nicht berechtigt, den Patienten aufzuklären. Laut § 630 e Abs. 2 BGB ist die Aufklärung mündlich in einem auf den individuellen Fall bezogenen Gespräch persönlich zwischen Arzt und Patient zu vollziehen. Die durch den Arzt ausgehändigten Merkblätter dürfen hierbei nur eine Gedächtnishilfe darstellen und die eigentliche mündliche Aufklärung nicht ersetzen! Diese Merkblätter sollten während des Gesprächs durch den Arzt mit Anmerkungen versehen werden. Es reicht nicht, dass man als Patient lediglich die Aufklärungsbögen und die Einverständniserklärung unterschreibt, um als aufgeklärt zu gelten! Laut § 630 e Abs. 2 S. 2 BGB hat der Patient auch einen Anspruch auf eine Kopie der Aufklärungsbögen.
Wann muss aufgeklärt werden?
Selbstverständlich muss die Aufklärung vor der Durchführung stattgefunden haben. Wichtig ist, dass Ihnen als Patient genug Zeit bleibt, das Für und Wider abzuwägen. Bei einem stationären Eingriff muss die Aufklärung mindestens am Vortag stattgefunden haben, allerdings nicht erst am Abend (außer Sie wurden erst spät eingeliefert und die OP ist aus medizinischer Sicht am nächsten Tag unbedingt notwendig oder von Ihrer Seite unbedingt gewollt). Bei einer ambulanten OP oder Behandlung ist es vom Einzelfall abhängig, wann aufgeklärt wird. Als Faustregel gilt: Das Aufklärungsgespräch muss zu einem Zeitpunkt erfolgen, zu dem der Patient noch frei entscheiden kann und nicht das Gefühl hat, dass er nunmehr einwilligen muss.
Ihnen ist im Verlauf der Darlegung sicherlich aufgefallen, dass einiges sehr allgemein gehalten wurde. Dies liegt daran, dass auch aus gesetzlicher Sicht an dieser Stelle sehr allgemein formuliert wurde. Die Frage der ordnungsgemäßen Aufklärung ist stets eine Einzelfallentscheidung. In jedem Fall muss geprüft werden, ob überhaupt ein Aufklärungsdefizit vorliegt. Wir halten es für ratsam, dass Sie sich für eine Einschätzung Ihres persönlichen Falles an einen Fachanwalt für Medizinrecht wenden. Mit fundierten medizinischen und rechtlichen Kenntnissen ist dieser in der Lage, etwaige Ausweichmanöver der Ärzte zu enttarnen und eventuelle Ausflüchte zu widerlegen.