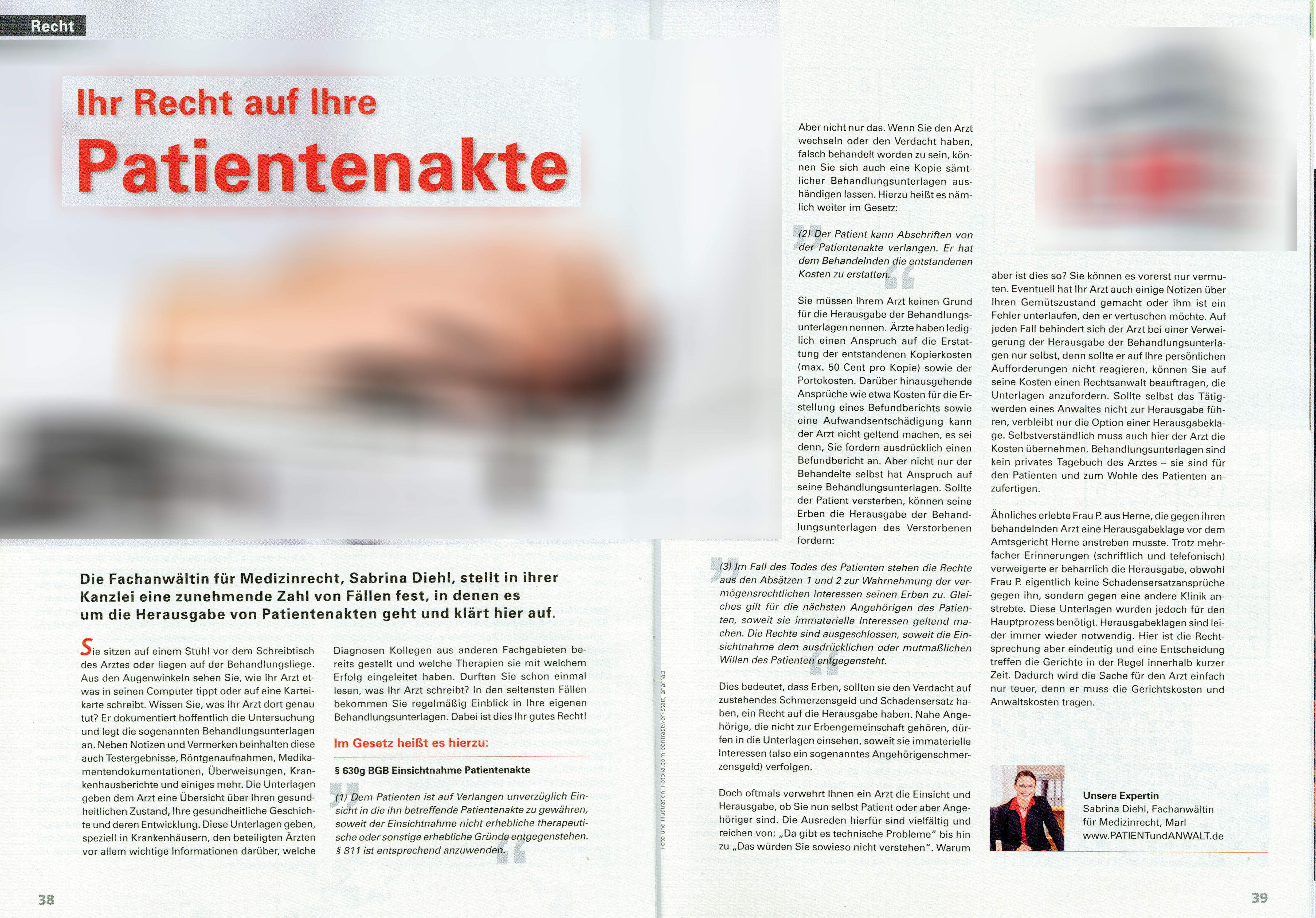Das Magazin aus Ihrer Apotheke - Ausgabe 25 aus 2015 - Ihr Recht auf Ihre Patientenakte
- Presse
- Printmedien
Die Fachanwältin für Medizinrecht, Sabrina Diehl, stellt in ihrer Kanzlei eine zunehmende Zahl von Fällen fest, in denen es um die Herausgabe von Patientenakten geht und klärt hier auf.
Sie sitzen auf einem Stuhl vor dem Schreibtisch des Arztes oder liegen auf der Behandlungsliege. Aus dem Augenwinkel sehen Sie, wie Ihr Arzt etwas in seinen Computer tippt oder auf eine Karteikarte schreibt. Wissen Sie, was Ihr Arzt dort genau tut? Er dokumentiert hoffentlich die Untersuchung und legt die sogenannten Behandlungsunterlagen an. Neben Notizen und Vermerken beinhalten diese auch Testergebnisse, Röntgenaufnahmen, Medikamentendokumentationen, Überweisungen, Krankenhausberichte und einiges mehr. Die Unterlagen geben dem Arzte eine Übersicht über Ihren gesundheitlichen Zustand, Ihre gesundheitliche Geschichte und deren Entwicklung. Diese Unterlagen geben, speziell in Krankenhäusern, den beteiligten Ärzten vor allem wichtige Informationen darüber, welche Diagnosen Kollegen aus anderen Fachgebieten bereits gestellt und welche Therapien sie mit welchem Erfolg eingeleitet haben. Durften Sie schon einmal lesen, was Ihr Arzt schreibt? In den seltensten Fällen bekommen Sie regelmäßig Einblick in Ihre eigenen Behandlungsunterlagen. Dabei ist dies Ihr gutes Recht!
Im Gesetzt heißt es hierzu:
§ 630g BGB Einsichtnahme Patientenakte
"(1) Dem Patienten ist auf Verlangen unverzüglich Einsicht in die ihn betreffende Patientenakte zu gewähren, soweit der Einsichtnahme nicht erhebliche therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe entgegenstehen. § 811 ist entsprechend anzuwenden. "
Aber nicht nur das. Wenn Sie den Arzt wechseln oder den Verdacht haben, falsch behandelt worden zu sein, können Sie sich auch eine Kopie sämtlicher Behandlungsunterlagen aushändigen lassen, Hierzu heißt es nämlich weiter im Gesetzt:
"(2) Der Patient kann Abschriften von der Patientenakte verlangen. Er hat dem Behandelnden die entstandenen Kosten zu erstatten."
Sie müssen Ihrem Arzt keinen Grund für die Herausgabe der Behandlungsunterlagen nennen. Ärzte haben lediglich einen Anspruch auf die Erstattung der entstandenen Kopierkosten (max. 50 Cent pro Kopie) sowie der Portokosten. Darüber hinausgehende Ansprüche wie etwa Kosten für die Erstellung eines Befundberichts sowie eine Aufwandsentschädigung kann der Arzt nicht geltend machen, es sei denn, Sie fordern ausdrücklich einen Befundbericht an. Aber nicht nur der Behandelte selbst hat Anspruch auf seine Behandlungsunterlagen. Sollte der Patient versterben, können seine Erben die Herausgabe der Behandlungsunterlagen des Verstorbenen fordern:
"(3) Im Fall des Todes des Patienten stehen die Rechte aus den Absätzen 1 und 2 zur Wahrnehmung der vermögensrechtlichen Interessen seinen Erben zu. Gleiches gilt für die nächsten Angehörigen des Patienten, soweit sie immaterielle Interessen geltend machen, Die Rechte sind ausgeschlossen, soweit die Einsichtnahme dem ausdrücklichen oder mutmaßlichen Willen des Patienten entgegensteht."
Die bedeutet, dass Erben, sollten sie den Verdacht auf zustehendes Schmerzensgeld und Schadensersatz haben, ein Recht auf die Herausgabe haben. Nahe Angehörige, die nicht zur Erbengemeinschaft gehören, dürfen in die Unterlagen einsehen, soweit sie immaterielle Interessen (also ein sogenanntes Angehörigenschmerzensgeld) verfolgen.
Doch oftmals verwehrt Ihnen ein Arzt die Einsicht und Herausgabe, ob Sie nun selbst Patient oder aber Angehöriger sind. Die Ausreden hierfür sind vielfältig und reichen von: "Da gibt es technische Probleme" bis hin zu "Das würden Sie sowieso nicht verstehen". Warum aber ist dies so? Sie können es vorerst nur vermuten. Eventuell hat Ihr Arzt auch einige Notizen über Ihren Gemütszustand gemacht oder ihm ist ein Fehler unterlaufen, den er vertuschen möchte. Auf jeden Fall behindert sich der Arzt bei einer Verweigerung nur selbst, denn sollte er auf Ihre persönlichen Aufforderungen nicht reagieren, können Sie auf seine Kosten einen Rechtsanwalt beauftragen, die Unterlagen anzufordern. Sollte selbst das Tätigwerden eines Anwaltes nicht zur Herausgabe führen, verbleibt nur die Option einer Herausgabeklage. Selbstverständlich muss auch hier der Arzt die Kosten übernehmen. Behandlungsunterlagen sind kein privates Tagebuch des Arztes - sie sind für den Patienten und zum Wohle des Patienten anzufertigen.
Ähnliches erlebte Frau P. aus Herne, die gegen ihren behandelnden Arzt eine Herausgabeklage vor dem Amtsgericht Herne anstreben musste. Trotz mehrfacher Erinnerungen (schriftlich und telefonisch) verweigerte er beharrlich die Herausgabe, obwohl Frau P. eigentlich keine Schadensersatzansprüche gegen ihn, sondern gegen eine andere Klinik anstrebte. Diese Unterlagem wurden jedoch für den Hauptprozess benötigt. Herausgabeklagen sind leider immer wieder notwendig. Hier ist die Rechtsprechung aber eindeutig und eine Entscheidung treffen die Gerichte in der Regel innerhalb kurzer Zeit. Dadurch wird die Sache für den Arzt einfach nur teuer, denn er muss die Gerichtskosten und Anwaltskosten tragen.