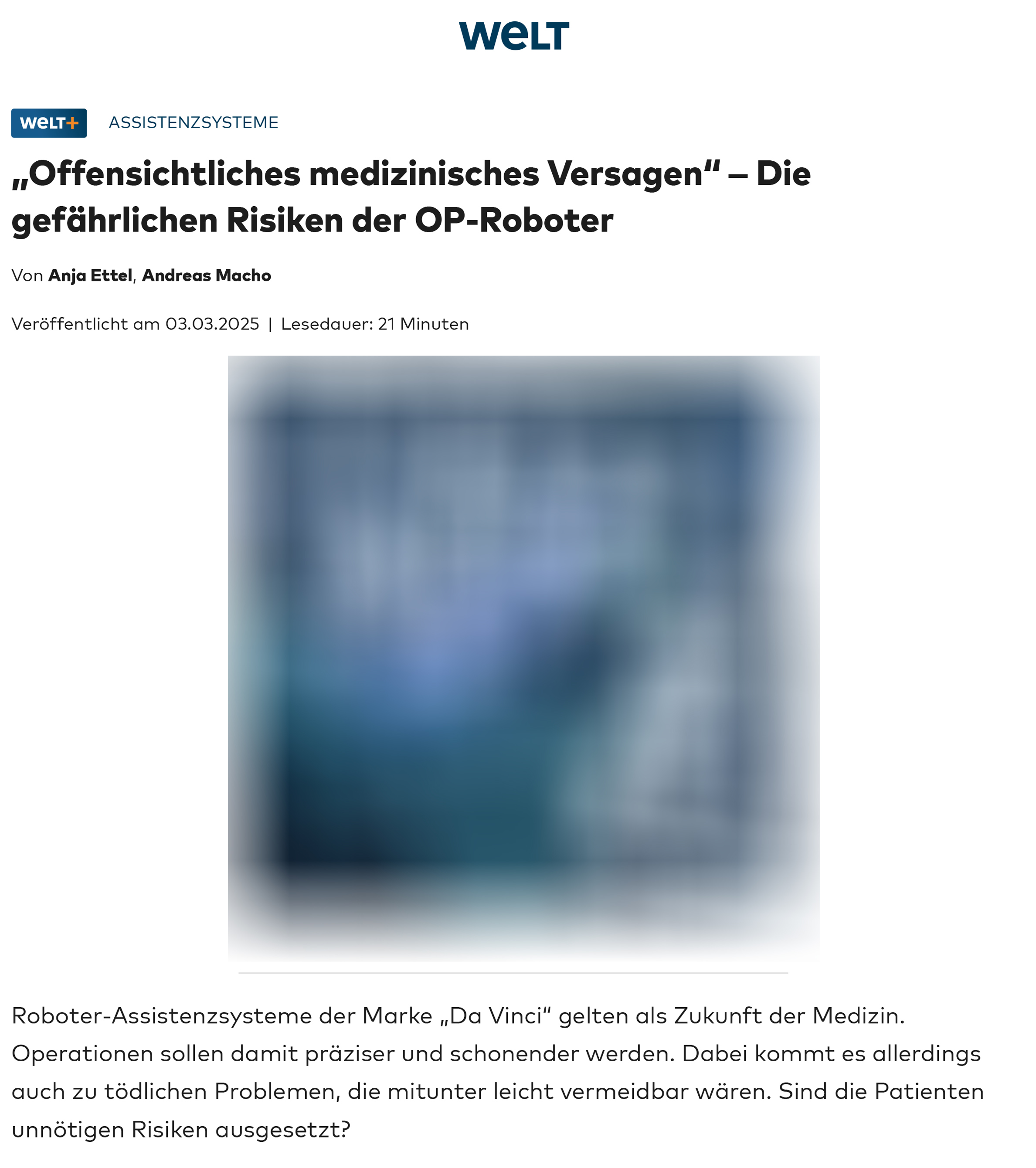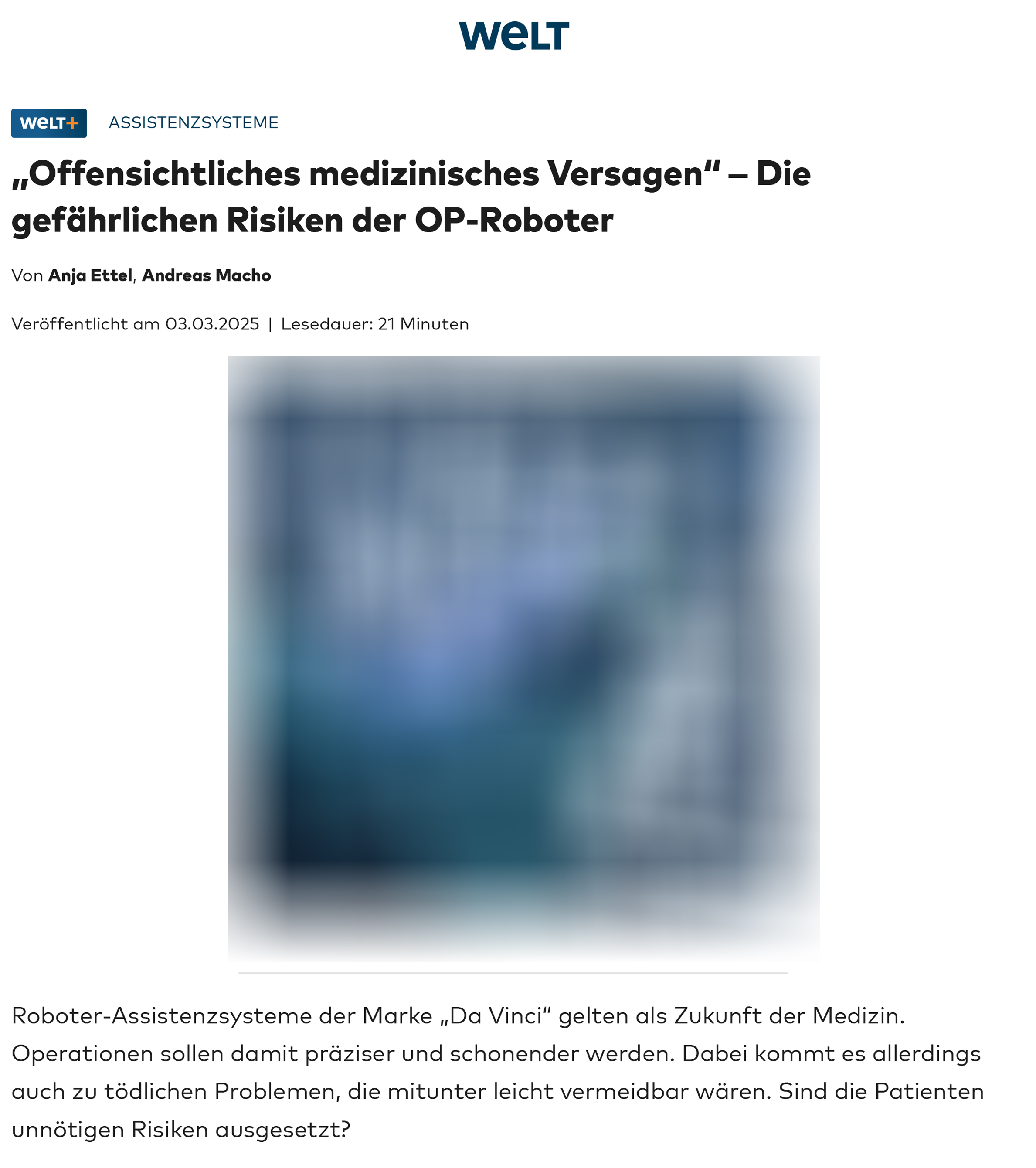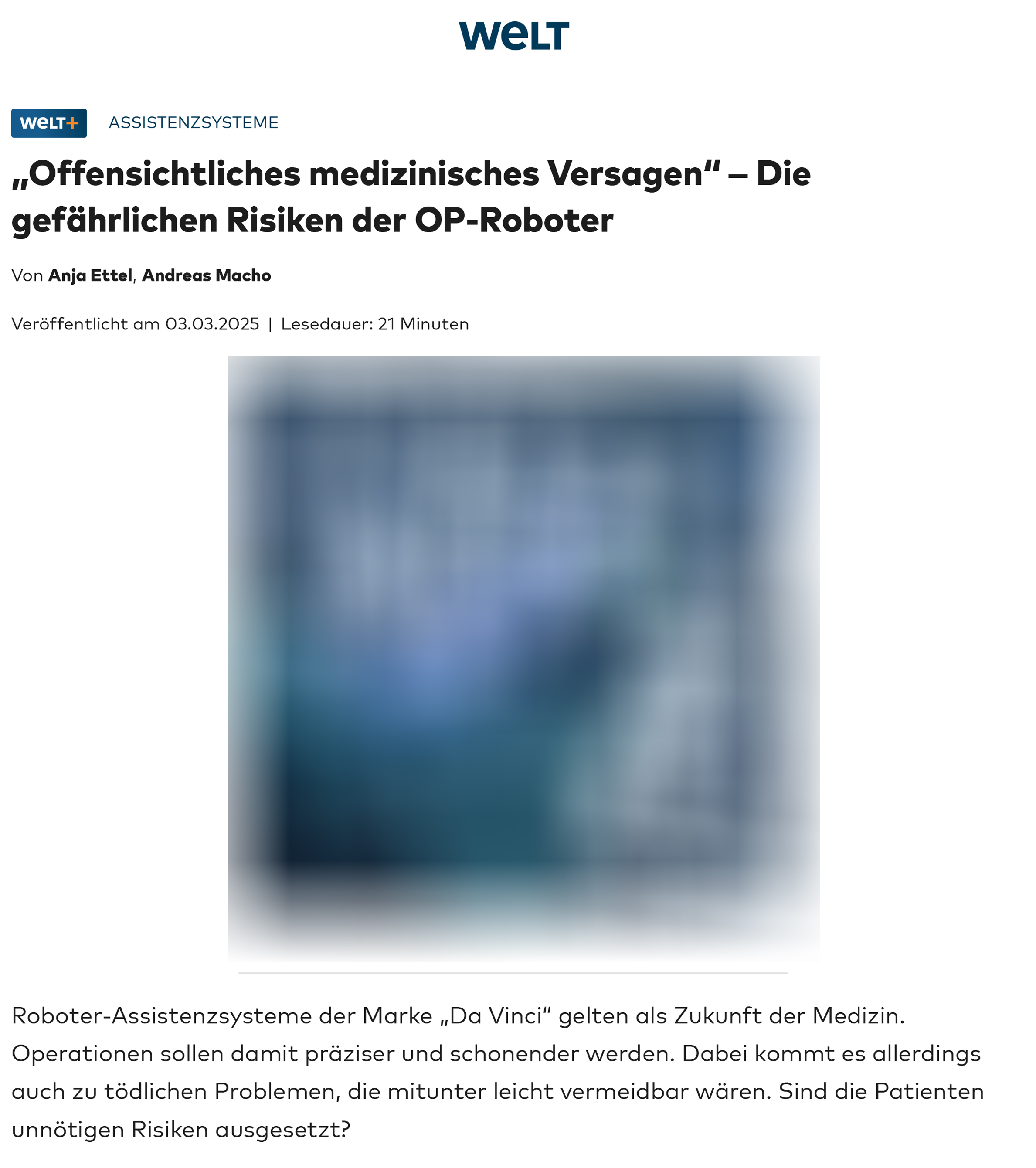
Quelle: "WELT" 03.03.25 - Anja Ettel, Andreas Macho
„Öffensichtliches medizinisches Versagen“ – Die gefährlichen Risiken der OP-Roboter
Von Anja Ettel, Andreas Macho
Veröffentlicht am 03.03.2025
Roboter-Assistenzsysteme der Marke „Da Vinci“ gelten als Zukunft der Medizin. Operationen sollen damit präziser und schonender werden. Dabei kommt es allerdings auch zu tödlichen Problemen, die mitunter leicht vermeidbar wären. Sind die Patienten unnötigen Risiken ausgesetzt?
Als Ayham Ghinagow den Operationssaal im Städtischen Klinikum Dresden betritt, liegt der Patient bereits regungslos auf dem OP-Tisch. Aus dem Mund ragt ein Schlauch, die Arme und Beine verschwinden unter einer grünen Folie. Bauch und Brust sind freigelegt. Am Monitor hinter der Liege überprüft ein Anästhesist die Werte des Patienten. „Vollnarkose hat eingesetzt“, ruft er dem Chirurgen Ghinagow zu. Unter dessen Atemschutzmaske ist ein zustimmendes Murmeln zu hören.
Ghinagow nimmt einen Stift und markiert vier Punkte auf dem Bauch des Patienten. Eine der OP-Schwestern rollt einen schrankhohen Roboter mit vier Greifarmen, jeder fast einen halben Meter lang, heran. „Intuitive Surgical“ ist auf ihnen graviert. So heißt die Firma aus Kalifornien, die dieses Roboter-Assistenzsystem gebaut und ihm seinen Namen verliehen hat: Da Vinci, wie das Universalgenie der Renaissance, das Pionierarbeit auch in der Medizin leistete. „Entfernung Lebertumor, linke Seite“, ruft Ghinagow in den OP-Saal. „Korrekt“, antwortet der Anästhesist und bestätigt, dass es sich um den richtigen Patienten handelt. „Dann kann es losgehen“, sagt Ghinagow. Er greift zum Skalpell und setzt per Hand winzige Schnitte an den markierten Punkten. Durch die aufgeschnittenen Stellen steuern der Chirurg und die OP-Assistenten die vier Greifer des Roboters in den Körper des Patienten.
Dann setzt sich Ghinagow vor die Steuerungskonsole an der Seite des Operationssaals, die aussieht wie eine überdimensionale Plastikbox. Sein Kopf verschwindet in einer Umrandung mit zwei eingelassenen Linsen. Durch sie blickt der Arzt nun ins Innere des Patienten. Die Kamera wird von einem der Greifarme geführt.
„Ich bewege mich jetzt entlang der Bauchdecke vor zur Leber“, ist Ghinagows Stimme im Saal über einen Lautsprecher zu hören. Mit zwei Joysticks lenkt er die Maschine: Seine linke Hand führt den Greifer, die rechte eine Zange. Mit einem Pedal kann er auf die beiden anderen Roboterarme zugreifen. Es wirkt wie ein Computerspiel – doch bereits ein kleiner Fehler kann hier tödliche Folgen haben.
Roboter „Da Vinci“ 9600-mal im Einsatz
500 Kilometer entfernt – in einer anderen Klinik, von einem anderen Ärzteteam, aber mit dem gleichen Roboter-Modell – wurde Sonja Lurz in Frankfurt/Main operiert. Die Patientin litt an Gebärmutterkörperkrebs, der bereits streute. Mithilfe eines „Da Vinci“ sollten befallene Lymphknoten aus dem Bauchraum entnommen werden. Zweieinhalb Jahre sind seither vergangen. Gerhard Lurz besucht seine Frau täglich, meist bleibt er mehrere Stunden. Er steht dann unter der hohen Douglasie mit den schweren Ästen, die ihm den Blick auf den Himmel versperren. Der Waldfriedhof im hessischen Hofheim ist der Ort, an dem er sich seiner verstorbenen Frau noch nahe fühlt. „Hätte sie dieser OP mit dem Roboter nicht zugestimmt, wäre sie noch bei mir“, sagt Lurz. Nun möchte er zumindest das Versprechen einlösen, das er seiner Frau am Sterbebett gegeben hat: dass ihr Fall aufgeklärt und Gerechtigkeit geschaffen wird
Zwei Patienten, zwei Ärzteteams, zwei Operationen, eine Gemeinsamkeit: das Roboter Assistenzsystem „Da Vinci“, das in seiner Art als global führend gilt. Das liegt auch daran, dass das Gerät bereits zur Jahrtausendwende auf den Markt kam und lange Zeit konkurrenzlos blieb. Mehr als 9600 dieser Chirurgiemaschinen von Intuitive Surgical sind heute weltweit im Einsatz, mehr als 340 davon in Deutschland. Für Europa bietet der Hersteller drei Modelle des Roboters mit verschiedenen Instrumenten an. Zugelassen sind sie unter anderem für Einsätze in der Urologie, Gynäkologie sowie bei Thorax- und allgemeiner Chirurgie.
Zahlreiche deutsche Kliniken werben mit „Da Vinci“ um Patienten. Ihr Versprechen: durch die minimalinvasive Technik sollen die Schnitte kleiner, die Ausführung präziser und die Heilung rascher ausfallen. Der Hype um das Gerät führt dazu, dass immer mehr Krankenhäuser bei Operationen auf die futuristischen Tentakel setzen. 2010 wurden hierzulande etwa 5300 Personen pro Jahr robotergestützt operiert, heute sind es fast 61.000.
Schattenseiten von Roboter-Assistenzsystemen
Was in den Werbeprospekten der Kliniken meist keine Erwähnung findet, sind die Schattenseiten und Risiken, die der Einsatz des Hightech-Geräts mitunter birgt. Seit seiner Einführung im Jahr 2000 gab es immer wieder Berichte über technische Defekte. Mehrfach kam es zu Verbrennungen an Patienten. Sogar Stromschläge durch Fehlfunktionen und herabfallende Teile während eines Eingriffs wurden registriert. In den USA sind zahlreiche Fälle von möglichem Versagen des Roboters vor Gericht anhängig. Die Vorkommnisse spiegeln einen der großen Konflikte in der Medizin: Die Frage, ob Fortschritt immer zum individuellen Vorteil des Patienten ist. Und welche Regeln es braucht, um Risiken bestmöglich zu begrenzen. Denn selbst wenn der Roboter funktioniert, wie es seine Entwickler vorgesehen haben: Schafft es der Mensch, ihn fehlerfrei zu bedienen? Dass Fortschritt in der Medizin nicht immer nur Vorteile für den Patienten bringt, zeigt ein Fall aus den frühen 1990er-Jahren. Damals verbreitete sich das Orthopädie-System „Robodoc (/print-welt/article324182/Vom-Roboter-operiert-dauerhaft-krank.html) “ in deutschen Kliniken. Das änderte sich allerdings abrupt, als sich herausstellte, dass eine Vielzahl von Patienten durch Operationen mit dem Gerät bleibende Schäden, etwa an Muskeln und Nerven, erlitten hatten. Die Technologie war damals schlicht noch nicht ausgereift. Nun häufen sich in Deutschland abermals die Vorkommnisse mit einem OP-Robotersystem. Recherchen von WELT führten zu mehreren Patienten, die sich durch den Einsatz von „Da Vinci“ geschädigt sehen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BfArM, registrierte zwischen Januar 2019 und Oktober 2024 insgesamt 249 Meldungen über „schwerwiegende Vorkommnisse mit robotischen Chirurgiesystemen“ des „Da Vinci“- Herstellers Intuitive Surgical. Das entspricht nahezu einem Vorfall pro Woche. Die hohe Zahl dürfte zwar auch der wachsenden Menge der Geräte in Kliniken geschuldet sein, zumal bei komplizierten Eingriffen immer mit Komplikationen zu rechnen ist – auch ohne Roboter. Und doch sind die Zahlen alarmierend.
Zwar hat der Hersteller das Gerät über die Jahre immer wieder nachgerüstet, um mögliche technische Mängel zu beseitigen und die Anwendung besser an die Bedürfnisse der Ärzte anzupassen. Doch nicht nur die Technik an sich macht „Da Vinci“ in einigen Fällen mutmaßlich zum Patientenrisiko – das Assistenzsystem ist bloß so gut wie der Chirurg, der es bedient. Konkrete Vorgaben für die Schulung gibt es nicht. Dabei befürworten selbst Ärzte eine stärkere Kontrolle. Noch dazu können zahlreiche Studien entgegen den Werbeversprechen keinen eindeutigen Nutzen beim Einsatz des Roboters im Vergleich zur herkömmlichen Schlüssellochtechnik nachweisen. Kritiker warnen deshalb, dass Kliniken die bis zu 2,5 Millionen Euro teuren Geräte mitunter deshalb einsetzen, um die Anschaffungskosten zu amortisieren. Haben sich die Häuser einem gefährlichen Trend ergeben?
Drama im OP-Saal
In der Wohnung von Gerhard Lurz ist es kühl. Und es ist dunkel. Wenn Besuch kommt, zieht der Rentner die Jalousie im Wohnzimmer nach oben, der Rest der Räume verharrt in Dunkelheit. „Ich kann die Helligkeit nicht mehr ertragen“, sagt der 66-Jährige. Nur wenn er sein Handy einschaltet und über die Fotos seiner verstorbenen Frau wischt, fällt für einen Moment etwas Licht vom kleinen Display auf sein Gesicht. Lurz war früher Schiedsrichter in der Kreisliga, vielleicht rührt daher sein Wunsch nach Gerechtigkeit und klaren Regeln. Wenn er spricht, teilt er vieles in Richtig und Falsch ein. Richtig, sagt Lurz, wäre es gewesen, seine Frau nicht zu operieren.
So habe das erste Krankenhaus, in dem sie behandelt wurde, lediglich eine Kombination aus Bestrahlung und Chemotherapie empfohlen. Doch dafür sei die kleine Klinik nicht gerüstet gewesen. Sonja Lurz wurde deshalb ins Frankfurter Markus-Krankenhaus der Klinikkette Agaplesion überstellt. Für falsch hält der Witwer, dass die Ärzte seine Frau dort zu einer Operation „überredet“ hätten, wie er es schildert. Noch dazu mit einer solchen Maschine. „Von diesem Roboter war bis zum OP-Tag nie die Rede“, sagt er. Einen Monat nach dem Tod hat er Klage gegen das Markus-Krankenhaus eingereicht. In Lurz’ Wohnzimmerregal stehen Aktenordner aufgereiht, voller OP-Protokolle und Anwaltsschreiben. Chronologisch hat der Witwer den gesamten Leidensweg seiner Frau abgeheftet. Am 7. Juli 2022 um 11:03 Uhr hatte die Operation begonnen.
Zunächst wurden Sonja Lurz, wie bei solchen Roboter-OPs üblich, wohl Markierungen auf den Körper gemalt. Von dem Steuerungsmodul aus manövrierte eine Chirurgin die Roboterarme durch diese Schnittstellen. Der Patientin wurden Lymphknoten im linken Becken entnommen. „Unter sicherer Schonung der genannten Strukturen erfolgt das komplette Entfernen des Lymphknoten- und Fettgewebes in diesem Bereich“, heißt es im OP-Bericht. Der Bauch der 62-Jährigen war während des Eingriffs mit Gas vollgepumpt. Eine Standardprozedur, um den Chirurgen die Sicht zu erleichtern. Anschließend wurde der Roboter neu positioniert, um Lymphknoten entlang der Hauptschlagader im Bauchraum zu entfernen. „Umdocken des „Da Vinci“-Roboters, dafür Anlage von drei weiteren Inzisionen und Einführen der Trokare unter Sicht“, notiert das OP-Protokoll dazu. Gerhard Lurz liest diese Stelle in den Unterlagen immer wieder. Denn genau hier wurde der Eingriff, der als Rettung im Kampf gegen den Krebs geplant war, zu einem Drama mit letztlich tödlichem Ausgang.
„Unerwünschte Ereignisse“ beim „Da Vinci“-Roboter
Wie sehr Krankenhäuser und Ärzte auf das Roboter-Assistenzsystem setzen, illustriert der Geschäftsbericht von Intuitive Surgical. Der Siegeszug der Roboter-Assistenten hat das Start up aus Kalifornien zu einem Unternehmen mit Milliardenumsätzen und einem Börsenwert von mehr als 211 Milliarden Dollar wachsen lassen. Die jüngste Quartalsbilanz verkündete einen Anstieg der Umsätze um 25 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Doch in dem Bericht findet sich noch ein anderer Vermerk: „Das Unternehmen wird derzeit als Beklagter in einer Reihe von individuellen Produkthaftungsklagen genannt, die in verschiedenen Bundesstaaten und Bundesgerichten eingereicht wurden.“ Die Food and Drug Administration (FDA), die Zulassungsbehörde für Arzneimittel und Medizinprodukte in den USA, überwacht das Unternehmen seit der Einführung des ersten „Da Vinci“-Modells. Demnach ist es allein in den Jahren 2019 bis 2024 in den Vereinigten Staaten zu 370 „unerwünschten Ereignissen“ gekommen, die so schwerwiegend waren, dass sie mit dem Tod der Patienten endeten.
Allerdings sei das Meldesystem anfällig für Verzerrungen, weshalb es „wissenschaftlich nicht angemessen“ sei, das Risiko der Geräte bloß anhand dieser Meldungen abzuleiten, teilt die FDA auf Nachfrage mit. Intuitive Surgical betont, dass die bloße Einreichung eines sogenannten Medical Device Report an Aufsichtsbehörden keine Schlussfolgerung darstelle und nicht bedeute, „dass das Gerät das unerwünschte Ergebnis oder Ereignis verursacht oder dazu beigetragen hat“. Zu „möglichen oder laufenden Gerichtsverfahren“ will sich das Unternehmen nicht äußern. Genaue Zahlen zu Vorkommnissen in Europa gibt es nicht. Bei den in Deutschland erfassten 249 schwerwiegenden Fällen mit dem „Da Vinci“ ging es besonders häufig um „Fehlermeldungen oder Nichtverfügbarkeit der Systeme sowie Beeinträchtigungen der Bewegung oder Ansteuerung der Systeme“, erklärt die mit der Risikoerfassung von Medizinprodukten betraute Behörde BfArM. 19 Mal habe der Hersteller „auf Basis der durch ihn durchgeführten Untersuchungen mitgeteilt, dass es sich dabei nicht um schwerwiegende Vorkommnisse handelte“, darunter falle etwa die „Fehlfunktion oder Verschlechterung der Eigenschaften oder Leistung eines Produkts“. Außerdem habe das US-Unternehmen seitdem vier Sicherheitskorrekturmaßnahmen gemeldet, um die Risiken weiter zu minimieren. Die Zahlen geben nur Auskunft über gemeldete technische Auffälligkeiten. Über konkrete Behandlungsfehler in deutschen OP-Sälen beim Einsatz des Roboter-Systems insgesamt führt das BfArM keine Statistik, weder das Bundesgesundheitsministerium noch die Landesaufsichten, die Bundesärztekammer, die Deutsche Krankenhausgesellschaft oder diverse medizinische Fachgesellschaften können Zahlen nennen. Wie oft Patienten durch „Da Vinci“-Operationen geschädigt werden, weiß niemand. Intuitive Surgical teilt auf Anfrage hierzu mit, „alle eingehenden Beschwerden im Zusammenhang mit der Verwendung unseres ‚Da Vinci‘-Systems“ zu untersuchen. „Die Überwachung unserer Systemleistung nach dem Inverkehrbringen ist Teil unseres Qualitätsanspruchs und von entscheidender Bedeutung für die Patientensicherheit.“ Berichte über „unerwünschte Ereignisse“ würden an die entsprechenden Aufsichtsbehörden übermittelt, mit denen das Unternehmen „regelmäßig interagiere“.
Fraglich ist zudem, welche konkreten Vorgaben es für den Einsatz des Roboters gibt. Intuitive Surgical bietet zwar ein umfassendes Schulungsprogramm in Europa an 20 Trainingszentren an. 76.000 Chirurgen sind nach Herstellerangaben weltweit an dem System ausgebildet worden. Allerdings betont das Unternehmen, dass medizinisches Personal selbst dafür verantwortlich sei, vor einem Eingriff festzustellen, ob es ausreichend geschult ist. Den Kliniken ist es freigestellt, mit welchem Grad an Erfahrung Ärzte das komplexe Gerät anwenden dürfen. Zwar sind Kliniken rechtlich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Ärzte an den Geräten geschult sind. Einheitliche Regeln oder behördliche Vorgaben, wie das im Detail auszusehen hat und wie die Einhaltung kontrolliert werden soll, gibt es jedoch nicht. Patientenschützer kritisieren diese Lücke: „Die Überprüfung des Kenntnisstands nach einer Einweisung ist nicht Pflicht, ist bei so komplexen Medizinprodukten allerdings geboten“, sagt Ruth Hecker, Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit. Einweisungen würden bisher nicht so ernst genommen, wie sie es sollten, und an komplexen Geräten auch nicht häufig genug wiederholt. „Das müsste kontrolliert werden“, so Hecker
Plötzliche Komplikationen während der OP
Im Dresdner OP-Saal steigt die Konzentration. Über einen Monitor ist zu sehen, wie Chirurg Ghinagow mithilfe der Greifarme einen Plastikschlauch um die zuführenden Gefäße zur Leber legt. Es ist Millimeterarbeit, die der Arzt an den winzigen Joysticks vollführen muss. Die Feinarbeit ist notwendig. „Sollten bei der Entfernung der Leber größere Blutungen auftreten, können wir das Organ damit abbinden und damit die Blutung verringern“, erläutert Ghinagow. Es ist nicht die einzige Vorsichtsmaßnahme, die das OP-Team getroffen hat. Auf dem Tisch vor der Schwester reihen sich neben den Instrumenten für den Roboter auch die herkömmlichen Arbeitsgeräte für das Öffnen und Spreizen der Bauchdecke. „Wir sind bei Operationen mit ,Da Vinci‘ immer darauf vorbereitet, dass wir schnell auf eine offene OP wechseln können“, sagt sie.
Wie plötzlich Komplikationen auftreten können, zeigt der Fall von Sonja Lurz. Elf Stunden und 21 Minuten dauerte der Eingriff im Markus-Krankenhaus. Offenbar lief dabei einiges nicht nach Plan. Als der Roboter umpositioniert wurde, um Lymphknoten entlang der Hauptschlagader im Bauchraum zu entnehmen, fiel die aufgepumpte Bauchdecke in sich zusammen, so steht es im Protokoll. Bemühungen, sie wieder aufzurichten, blieben erfolglos. Der Versuch, den Chefarzt der Abteilung hinzuziehen, scheiterte. Schließlich entschieden sich die beiden Chirurginnen für eine klassische Operation: Der Roboter wurde zur Seite gefahren, Lurz’ Bauch mit einem Querschnitt geöffnet. Irgendwann an diesem langen Operationstag wurde der Dünndarm der 62-Jährigen verletzt und der linke Harnleiter durchtrennt. Unklar ist, ob mit dem Roboter oder dem klassischen Skalpell. Die Ärzte bemerkten das offenbar erst am 9. Juli, eineinhalb Tage später. Flüssigkeit aus Galle und Darm verbreitete sich im Bauchraum der Patientin. Das gesamte Bauchfell entzündete sich, eine schwere Sepsis war die Folge. Das Markus Krankenhaus kommentiert weder die OP-Berichte noch die Aussagen von Gerhard Lurz. Fragen dieser Zeitung bleiben mit Verweis auf das laufende juristische Verfahren unbeantwortet.
Insgesamt 20 weitere Eingriffe sind notwendig, um Lurz nach der mutmaßlich misslungenen ersten Operation wieder zu stabilisieren. Sechs Wochen ringen die Ärzte um ihr Leben. Sechs Wochen, in deren Verlauf sie zunächst intubiert, dann per Luftröhrenschnitt beatmet werden muss. Die Bauchdecke kann wegen der vielen Operationen schließlich nicht mehr zugenäht werden. Sonja Lurz stirbt am 23. August 2022. Als Todeszeitpunkt hält das Protokoll 3:34 Uhr fest.
Assistenzsystem nur für bestimmte Situationen
Drei Stockwerke über dem Operationssaal des Städtischen Klinikums in Dresden hat der Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie Sören Torge Mees sein Büro. Mees gilt als ein versierter Operateur mit „Da Vinci“ – eine dreistellige Anzahl an Operationen hat er nach eigenen Worten mit dem System absolviert. „Wenn ich persönlich einen Tumor am Enddarm hätte, würde ich mich auf jeden Fall mit ,Da Vinci‘ operieren lassen“, sagt er. Der Eingriff hätte gegenüber anderen Methoden den Vorteil, auch an schwer zugänglichen Stellen im Körper minimalinvasiv, mit voll beweglichen Roboterhänden und 3D-Kameraoptik operieren zu können. Doch Mees setzt das Assistenzsystem nur in bestimmten Situationen ein. „Als Faustregel für einen Einsatz gilt: Die OP sollte möglichst in eine Richtung im Körper erfolgen, der Eingriff muss bestmöglich standardisiert sein, und wenn es um die Entfernung eines bösartigen Tumors geht, darf dieser noch nicht in andere Organe gestreut haben“, erklärt der Chefarzt.
In komplizierteren Fällen, etwa wenn mehrere Organe betroffen sind oder die Chirurgen mit dem Auftreten von Problemen zu rechnen haben, kann „Da Vinci“ Mees zufolge nicht die beste Wahl sein. „Komplikationen sind mit dem Roboter-System teilweise schwieriger zu handhaben als bei herkömmlichen OP-Methoden“, sagt der Mediziner. „Die Sicht der Kamera ist durch unerwartet auftretende Blutflüsse oft beeinträchtigt. Zudem kann der Chirurg andere Organe bei akuten Komplikationen nicht so einfach zur Seite schieben, um einen besseren Blick auf das Geschehen zu haben, wie bei einer offenen OP.“ Und dann sei da noch ein weiterer Punkt, ein entscheidender: „Wenn der Chirurg mit ,Da Vinci‘ arbeitet, sitzt er abgeschottet in dem Gehäuse und spricht mit den anderen Leuten im OP vorrangig über das Funksystem. Er trifft seine Entscheidungen vorrangig allein. Bei schwierigen Situationen entscheidet das ganze Team, was bei offenen Operationen einfacher sein kann, da alle Teammitglieder denselben Blick haben.“
Kritik am Hightech-Helfer
Im Ausland wird das „Da Vinci“-System teilweise kritischer beurteilt als in Deutschland. In der Schweiz kam bereits vor einigen Jahren eine Diskussion über dessen Nutzen auf. Auch in Österreich blicken offizielle Stellen kritisch auf das Hightech-Gerät. Claudia Wild, Geschäftsführerin des AIHTA Instituts in Wien, das im Auftrag der Regierung und der Sozialversicherungsträger Kosten und Nutzen neuer Therapien überprüft, sieht im Einsatz von Roboter-Assistenzsystemen keineswegs die Zukunft der Medizin. „Die meisten Ärzte lieben diese Geräte, weil sie damit bequemer arbeiten können, als in gebückter Haltung am OP-Tisch zu stehen. Aber für die Patienten ist der Roboter bisher kein Vorteil“, sagt die Gesundheitsexpertin. Wild zählt auf, was damit gemeint ist: Gemessen am Blutverlust bei einer Operation sei der Roboter der Schlüssellochtechnik nicht zweifelsfrei überlegen. Auch die Länge des Klinikaufenthalts sei im Vergleich nicht kürzer, die Komplikationsrate nicht geringer und die Operationsdauer sogar eher länger. Ihr Fazit: „Das Ergebnis einer Roboter-OP muss nicht schlechter sein als das herkömmliche laparoskopische Verfahren, es ist aber meistens auch nicht besser“, sagt Wild.
Jedoch koste die Technik ein Vielfaches. Aktuellen Studien zufolge fallen die Mehrkosten teilweise rund ein Fünftel höher aus als bei üblichen minimalinvasiven Operationen. „Betriebswirtschaftlich gesehen ist es daher Unsinn, eine Operation mit einem Roboter Assistenzsystem durchzuführen und das Solidarsystem damit zu belasten“, sagt Wild. Insgesamt dreimal hat das Wiener Institut Eingriffe mit dem ,Da Vinci‘ evaluiert. Das Ergebnis fiel jedes Mal ähnlich aus: Potenzielle Vorteile roboterassistierter Eingriffe konnten bisher nicht belegt werden. Intuitive Surgical teilt dazu mit, dass das „Kosten-Nutzen-Verhältnis von vielen Faktoren“ abhänge, wie etwa dem Erfahrungs- und Fachwissen des Arztes, der Spezialisierung des Krankenhauses, der Patientendemografie und den Besonderheiten jedes einzelnen Falles: „Es ist allgemein anerkannt, dass die robotergestützte Chirurgie im Vergleich zur laparoskopischen Chirurgie Vorteile bieten kann, wenn die Entscheidung für die robotergestützte Chirurgie als Behandlungsmethode durch die richtigen Faktoren untermauert wird.“ So gebe es mehr als 43.000 von Experten begutachtete Artikel, die insgesamt die Sicherheit und Leistung der robotergestützten Chirurgie unterstützten.
Dass sich die „Da Vinci“-Roboter trotz unterschiedlicher wissenschaftlicher Bewertungen derart flächendeckend in Kliniken durchgesetzt haben, liegt laut Wild vor allem am geschickten Marketing. „Der Hersteller veranstaltet Trainingscamps, in denen Ärzte auf dem Roboter geschult werden. Viele Mediziner kommen dann ganz beseelt zurück und wollen auch so ein Gerät. Entsprechend sehen sich selbst kleinere Kliniken unter Druck gesetzt, auch so einen Roboter anzuschaffen, um nicht als unmodern dazustehen“, sagt sie. „Und wenn der Roboter dann schon mal da ist, will man ihn natürlich auch einsetzen.“ Und das ist durchaus kritisch zu betrachten. Eine Kommission der Schweizer Arzneimittelaufsicht SMB warnte bereits im Jahr 2018 davor, dass die hohen Anschaffungskosten der Hightech-Geräte dazu führen könnten, „dass der Einsatz von Robotersystemen forciert wird mit dem Ziel einer besseren Amortisation und zur Schaffung von Schulungsmöglichkeiten für das chirurgische Personal“. Einen Beleg dafür gibt es allerdings nicht, weil diese OPs und ihre Ergebnisse bisher nicht systematisch erfasst werden. Auch die Frage, ob die Mediziner trotz Schulungen wirklich fit genug sind, um auch bei Komplikationen mit dem technischen Gerät zurechtzukommen, bleibt offen. „Das Dunkelfeld ist sehr groß“, sagt Matthias Weigl, Direktor des deutschlandweit einzigen Instituts für Patientensicherheit in Bonn. „Es gibt zu wenig verlässliche Daten über den Verlauf und mögliche Probleme bei Operationen, ob mit oder ohne Roboter.“
Der Siegeszug der Roboter-Assistenzsysteme birgt noch ein weiteres Risiko, das auf den ersten Blick gar nicht erkennbar ist. Es hat mit dem Generationswechsel in den Kliniken zu tun. „Bisher hatten wir es in den Kliniken mit Chirurgen zu tun, die vor der Einführung der Roboter ganz konventionell operiert haben“, sagt Weigl. „Wenn dann bei der OP mit dem Roboter eine größere Komplikation auftritt, zum Beispiel eine unstillbare Blutung, sind diese Chirurgen in der Lage, auf das offene Verfahren zurückzuwechseln, denn das war vorher der Standard.“ Die jüngere Chirurgengeneration, die das Operieren vor allem am Roboter lerne, verliere diese wertvolle Ausweichoption – sofern die Kliniken nicht rechtzeitig reagierten.
Überforderte Ärzte?
Für Witwer Gerhard Lurz ist in den vergangenen zweieinhalb Jahren sein Handy zum wichtigsten Verbündeten geworden. Die Bildergalerie auf dem Smartphone hält die Erinnerung an seine geliebte Frau wach. Und es verbindet Lurz mit Michaela Bürgle, seiner Anwältin für Medizinrecht aus Frankfurt. Der Prozess zieht sich mittlerweile fast zwei Jahre, aktuell überprüft ein gerichtlich bestellter Gutachter die Vorkommnisse. „Ich habe schon viele Fälle betreut, in denen bei Operationen etwas schiefgelaufen ist. Aber eine derartige Aneinanderreihung von offensichtlichem medizinischen Versagen habe ich noch nie erlebt“, sagt Anwältin Bürgle. Wenn man sich den Verlauf des Eingriffes durchlese, dränge sich der Eindruck auf, dass es den beiden operierenden Ärztinnen an Erfahrung gemangelt habe, den Roboter richtig einzusetzen, so die Juristin.
Zu diesem Schluss kommt auch ein Gutachten der Krankenkasse von Sonja Lurz: „Auffällig ist (…) die beschriebene Bitte um Anwesenheit des Chefarztes bei der Operation, der aber zeitlich verhindert war. (...) Anhand dieser Beschreibung besteht der begründete Verdacht, dass die operierende Ärztin mit dieser Operation überfordert war“, heißt es. „Dieser erste Fehler hat alles andere ins Rollen gebracht und wirft Zweifel auf an den internen Kontrollsystemen innerhalb des Krankenhauses“, sagt Bürgle. Vorfälle mit dem „Da Vinci“ beschäftigen noch weitere Anwälte. Etwa Sabrina Diehl, Fachanwältin für Medizinrecht aus Herne in Nordrhein-Westfalen. Sie betreut derzeit einen Patienten, der wegen eines bösartigen Tumors im Dickdarm mit dem Assistenzroboter operiert wurde. Der Einsatz des Geräts sollte auch dieses Mal einen möglichst schonenden OP-Verlauf gewährleisten. „Das Gegenteil war der Fall“, erklärt Diehl.
Die Entfernung des Tumors lief zunächst störungsfrei. Allerdings stellten die Ärzte fest, dass sie bei der Entnahme zu knapp am umliegenden Gewebe operiert und möglicherweise nicht alle Krebsspuren ausgemerzt hatten. Deshalb wurde der „Da Vinci“ ein zweites Mal am Patienten angedockt. Doch dadurch verlängerte sich die Zeit des Eingriffes erheblich. Und offenbar stieg dadurch der Druck auf die Beine des Mannes. Blutgefäße wurden stark gequetscht. Seither leidet der Patient unter großen Schmerzen und ist auf eine Gehhilfe angewiesen. Das sogenannte Kompartment-Syndrom ist eine schwere Nebenwirkung, die sich nach Diehls Worten speziell aus dem Einsatz eines OP-Roboters ergeben kann. „Mein Mandant ist darüber zu keinem Zeitpunkt aufgeklärt worden“, kritisiert die Anwältin. „Andernfalls hätte er sich auf keinen Fall für diese Art der Operation entschieden.“
Operieren mit „Da Vinci“ sicherer machen
Dabei gäbe es Möglichkeiten, das Operieren mit „Da Vinci“ sicherer zu machen. Die Klinik Dresden hat etwa hausinterne Regeln erlassen, welcher Arzt mit welcher Erfahrung welche Krankheiten operieren darf. Chefarzt Mees sieht Verbesserungspotenzial, denn noch liegen die Details im Ermessen des jeweiligen Krankenhauses: „Das große Vorbild der Chirurgie muss die Flugbranche sein. Dort sind sämtliche Prozesse standardisiert und durch Back-up-Systeme mehrfach abgesichert“, sagt er. „Beim Einsatz der Roboter-Assistenzsysteme haben wir diese Standardisierung noch nicht erreicht.“
Für Mees wäre es im Sinne der Patientensicherheit etwa denkbar, dass Chirurgen standardisierte Vorgaben über ihre Ausbildung an den Robotern nachweisen müssen, ehe sie Patienten selbstständig damit operieren dürfen. „Für jeden Facharzttitel gibt es diese Vorgaben letztlich auch.“ Empfohlen werden solche Zertifikate auch von der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Verbreitet sind sie bislang nicht: Solche „Personenzertifikate“ seien bei den betroffenen Fachgesellschaften „derzeit in der Entwicklung“, teilt die Organisation mit.
Wunsch nach Gerechtigkeit
In Dresden steuert die OP ihrem Höhepunkt entgegen. „Jetzt kommen wir zum kritischen Part“, ruft Ghinagow der Assistenzärztin zu, „jetzt müssen wir die Leber durchschneiden. Wenn es jetzt zu größeren Blutungen kommt, könnte uns das Probleme bereiten.“ Der Chirurg durchtrennt mit den Greifern die Leber, die Assistenzärztin setzt mit einem fünften Arm, der ebenfalls in die Bauchdecke des Patienten eingeführt wurde, Klammern, um die Blutung zu stillen. „Links, links“, ist Ghinagows Stimme aus dem Lautsprecher zu hören, „höher, höher!“ Über den Monitor verfolgt der Chirurg, wie seine Anweisungen ausgeführt werden. „Noch ein Stück nach rechts. Ja! Klammern!“ Die Stimmen im Saal verebben. Die entscheidende Klammer, um die Blutung zu stillen, ist gesetzt.
Chirurg Ghinagow führt die Roboterarme aus dem Bauch des Patienten hinaus, die OP Assistentinnen rollen den Roboter beiseite. Doch noch ist die OP nicht beendet. Ghinagow setzt mit dem Skalpell einen Schnitt am unteren Bauchrand, durchschneidet die Haut, das Bauchfell. Er holt ein handgroßes Stück der Leber aus dem Bauchraum. Der Chirurg legt es auf den Tisch vor sich und schneidet es auf. „Hier ist eindeutig der Tumor zu sehen“, sagt er. Die Stimmung im OP-Saal entspannt sich. Ghinagow streift die Einmalhandschuhe ab und schaut auf die Uhr. „In einer Stunde beginnt die nächste OP. Wir werden wieder mit ,Da Vinci‘ operieren“, sagt er. Der Einsatz des Roboters ist längst Routine für den erfahrenen Chirurgen. Aus seiner Sicht bringt das Gerät zahlreiche Vorteile. Um diese optimal zu nutzen, muss ein Team auf den Hightech-Helfer jedoch so eingespielt sein wie jenes in Dresden.
In Hofheim sind die Blumentöpfe auf der Fensterbank im Wohnzimmer von Gerhard Lurz verwaist. Die Pflanzen, die seine Frau stets mit viel Liebe gehegt habe, längst eingegangen. „Meine Frau würde schimpfen mit mir deswegen“, sagt Lurz und lacht. Sein Lachen kippt schnell in ein Schluchzen. Lurz blickt auf den kleinen Tisch in der Ecke des Wohnzimmers, wo Fotos seiner Frau und Trauerkarten zu ihrer Beerdigung wie auf einem Altar arrangiert sind. Die Bilder zeigen Sonja Lurz, lächelnd, umgeben von ihrer Familie. Nach ihrem Tod habe es ein Gespräch gegeben mit der Klinikleitung der Gynäkologie und einer der beiden behandelnden Ärztinnen, erzählt Lurz. „Dass mal Fehler passieren, sei doch menschlich, haben sie mir gesagt“, erinnert er sich und schüttelt den Kopf. Nicht einmal eine Entschuldigung sei den Ärzten über die Lippen gekommen – „damals nicht und bis heute nicht“. Das sei nicht richtig. Dabei hätte ihm, so sagt er, schon eine einfache Entschuldigung gereicht, um sein Versprechen an die verstorbene Frau einzulösen: Gerechtigkeit.